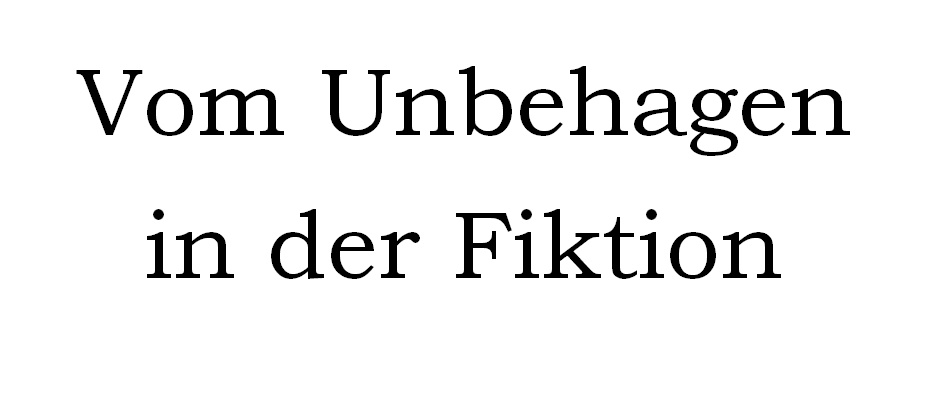Veranstaltungsreihe: Vom Unbehagen in der Fiktion
Das Netzwerk der Literaturhäuser hat in Kooperation mit der Bundeszentrale für Politische Bildung eine Veranstaltungsreihe mit dem Titel „Vom Unbehagen in der Fiktion“ veranstaltet. Auch auf diesem Blog hat sich in diesem Jahr gezeigt, dass sich immer wieder Bücher finden, deren Stoff auch dokumentarisch Realitäten abbildet, die Distanz zwischen Fakt und Fiktion schrumpft. Gleichzeitig sorgen Debatten über Fake News und Präsidenten die Fakten beugen dafür, dass Bereiche, die man eigentlich klar getrennt wahrnehmen möchte verschwimmen.
Der Trend zu realistischen Romanen ist nicht neu und hat mich auch schon während meines Germanistikstudiums begleitet. In meiner Abschlussarbeit habe ich mich intensiv mit autofiktionaler Prosa beschäftigt. Dies alles greift die Veranstaltungsreihe auf. Für diesen Blog hat Stefan Katzenbach zwei Veranstaltungen digital verfolgt und darüber geschrieben. Stefan hat mit mir gemeinsam Germanistik studiert und ist bei vielen Lesungs-, Festival- und Messebesuchen mein Begleiter gewesen. Er wird den Blog in Zukunft bei Berichten aus dem Literaturbetrieb unterstützen und wir werden sicherlich auch einige Hintergründe aus Literatur- und Kulturwissenschaft im kommenden Jahr gemeinsam betrachten.
Zunächst aber nachfolgend der Bericht von Stefan zur Veranstaltung der Reihe in Berlin.
Die Diskussionsrunden sind auch unter dem Link
https://www.literaturhaus.net/projekte/vom-unbehagen-in-der-fiktion
zu finden.
„Autofiktionen bieten Subjektmodelle für bestimmte Klassen an“
Am 26.11. fand im Literaturhaus Berlin eine Diskussion über das Verhältnis von Fakten und Fiktion in der deutschen Gegenwartsliteratur statt. Im Zentrum der Veranstaltung, die im Rahmen der von mehreren Literaturhäusern organisierten Reihe „Das Unbehagen in der Fiktion“, stattfand, stand die Frage warum es aktuell so viele Romane mit autobiographischen und autofiktionalen Elementen gibt.
Deniz Ohdes „Streulicht „und Christian Barons Buch „Ein Mann seiner Klasse“ sind nur zwei Beispiele dafür, dass es in der deutschen Gegenwartsliteratur aktuell eine Tendenz gibt, Bücher zu veröffentlichen, die einen Hintergrund in der Lebensgeschichte des Autors oder der Autorin haben. Doch ist es überhaupt sinnvoll eine strikte Trennung zwischen autobiographischem und fiktionalen Schreiben anzulegen? Diese Eingangsfrage stellte die Moderatorin Catherine Newmark zu Beginn der Diskussion. Für den Schriftsteller Deniz Utlu ist eine solche Trennung problematisch: „Es gibt keinen absolut autobiographischen Text“, zeigte er sich überzeugt. Jede Erzählung sei sofort Fiktion, der Unterschied zwischen Fakt und Fiktion somit eine Behauptung. Ähnlich sieht das der Literaturwissenschaftler und Literaturkritiker Christian Metz, eine solche Trennung sei „gekünstelt“, vielmehr existiere in jedem Text ein „Set aus Fakten und Fiktion“, eine Art „Pool“, in dem beide Formen miteinander interferieren würden. „Da ist es dann sehr gut beschreibbar, was in diesen Abstufungen passiert“, so Metz. Einen praktischen Aspekt in den aktuellen autofiktionalen Büchern sieht die Kulturwissenschaftlerin Hannah Engelmeier: „Autofiktionen dienen dem deutschen Publikum zur überprüfenden Lektüre“, glaubt sie, sie könnten überprüfen ob „Protagonist und Autor deckungsgleich“ seien. Sie selbst habe bei Karl Ove Knausgaards neuem Roman „Aus der Welt“ auch „allem hintergegooglet“. Dass diese Form des scheinbar authentischen Schreibens auch Gefahren birgt, darauf weist die Soziologin Silke van Dyk hin. So könne der Verweis auf die scheinbar authentische Geschichte das Argumentieren ersetzen, das Erzählte werde durch das Erlebte legitimiert. So immunisiere sich das Authentische und sei „nicht mehr kritisierbar“.
Interessante Geschichten und Erklärung der Welt
Doch warum ist diese Form des Schreibens auch aktuell beim Publikum scheinbar so beliebt? Für Christian Metz hat das, bezogen auf die Autoren, mit zwei Punkten zu tun: Zum einen gäbe es aktuell allem Anschein nach „eine hohe Kapazität des Erzählens“, besonders eine Generation junger Autoren habe die Möglichkeit biographisch gefärbte Erzählungen öffentlich zu machen und scheinbar auch „die Wut zu erzählen“ und fühle sich verpflichtet von den Widerständen, die ihnen bei ihrem Aufstieg begegnet sind, zu berichten. Dieses Berichten von Widerständen sei es auch, dass den Reiz ausmache, auch für das Publikum. Diese Stimmen von Leuten, die sonst wenig gehört würden, seien nun öffentlich und deren Geschichte selbst so interessant, dass es gar nicht nötig sei, da übermäßig zu fiktionalisieren. Silke van Dyk sieht die Situation auf dem Buchmarkt auch durch die aktuelle politische Lage bedingt: Die gesellschaftlichen Bedingungen seien interessant, um solche Bücher zu schreiben, in Verbindung mit „sozialen „Bewegungen entstünden auch „neue Emanzipationen“. Auf einen ähnlichen Punkt verwies Hanna Engelmeier: „Autofiktionen bieten Subjektmodelle für bestimmte Klassen an“. Bei dieser Vermittlung eines gesellschaftlichen Bildes der Identitätsfindung, das durch die Literatur vermittelt wird, gibt es allerdings auch Gefahren. Die reine inhaltliche Fokussierung auf Literatur verleite dazu die Erzählung als exemplarisch für eine bestimmte Klasse zu lesen und könne dadurch Stereotype reproduzieren. Ein ähnliches Problem sieht auch Deniz Utlu, für ihn sei die „ästhetische Frage entscheidend“. „Wenn ich einen Roman schreibe, dann habe ich den Anspruch politisch-ästhetisch zu reflektieren, um möglichst frei von Stereotypen zu sein“, sagte er. Gelänge dies nicht, dann verlöre der Roman seine „literarische Kraft“.
Immunisierung gegen Kritik und Verfehlung der Autofiktion
In den Augen Silke van Dyks hätte eine solche Verkürzung von Literatur auch gefährliche politische Konsequenzen: Aktuell herrsche eine große Nachfrage nach Authentizität, da ehemals gängige Erklärungsmuster nicht mehr funktionieren würden, um gesellschaftliche Phänomene zu erfassen. Dem gegenüber schaffe dann scheinbare Authentizität eine „Richtigkeit“ in ihren Aussagen über die Welt. Die Verifizierung dieser Aussagen anhand der eigenen Erfahrung schaffe aber eine „Immunisierung“ gegenüber Kritik. Dies sei ernst zu nehmen, schließlich sei dies ein gängiges Verfahren populistischer Politiker.
Doch nicht nur aus literarischer und politischer Sicht ist eine rein inhaltlich geprägte Sicht auf autofiktionale Literatur problematisch. Schließlich gehe sie „an der Autofiktion vorbei“, in dieser werde nicht primär „über mich“ geredet, sondern es ginge im Gegenteil um die „Depotenzierung des starken Ichs“, dieses diene als „Erzählfilter“, der die „Abmischung“ der einzelnen literarischen Elemente transparent mache, so Hannah Engelmeier. Ähnlich sieht das Christian Metz: Die Unterscheidung zwischen Fakt und Fiktion sei „fad, davon können wir uns verabschieden. Interessante Texte arbeiten gegen das Ich und öffnen Räume“, sagte er.
Stefan Katzenbach